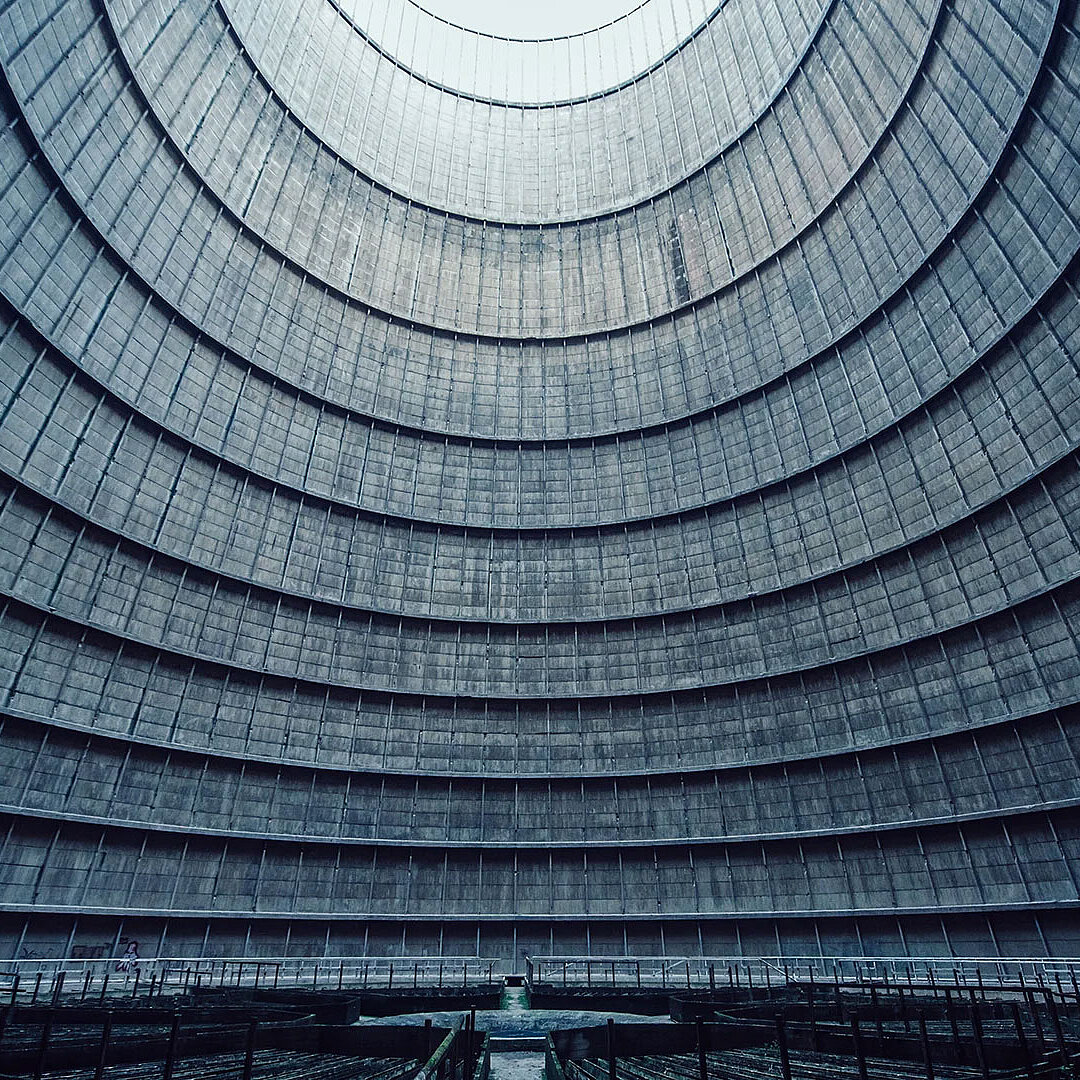-
Dem Umbau der Braunkohlenwirtschaft kommt bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zu.
Denn Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger, 46 Prozent der CO₂-Emissionen des Stromsektors gehen auf die Braunkohle zurück – das ist mehr als der CO₂-Ausstoß des gesamten Straßenverkehrs. Die Klimaschutzziele Deutschlands lassen sich ohne eine deutliche Reduktion der Braunkohlenutzung nicht erreichen.
-
Die Braunkohlenindustrie war in der Vergangenheit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, hat heute aber nur noch regionalwirtschaftliche Relevanz.
Während die Braunkohlenindustrie im 20. Jahrhundert für die Energieversorgung in West- und Ostdeutschland zentral war, spielt sie für die deutsche Volkswirtschaft heute eine untergeordnete Rolle. Für die drei Förderreviere im Rheinland, in Mitteldeutschland und in der Lausitz ist sie jedoch von hoher regionalwirtschaftlicher Bedeutung, die über die Zahl der insgesamt rund 19.000 aktiv Beschäftigten hinausgeht.
-
Braunkohlekraftwerke stehen derzeit unter starkem ökonomischen Druck.
Aufgrund der niedrigen Börsenstrompreise können neuere Braunkohlekraftwerke zwar die Betriebskosten des Kraftwerks und der angeschlossenen Tagebaue decken, jedoch nicht mehr die Kapitalkosten der Investition. Für ältere Braunkohlekraftwerksblöcke lohnen sich größere Erhaltungs- oder Erweiterungsinvestitionen in den liefernden Tagebauen nicht mehr. Sobald bei diesen Tagebauen fixe Betriebskosten in größerem Umfang reduziert werden können, ist eine Stilllegung wirtschaftlicher als der Weiterbetrieb.
-
Der Braunkohlenbergbau ist durch ein hohes Maß an langfristig angelegter Regulierung und Planungsprozesse gekennzeichnet.
Ökologische und energiewirtschaftliche Anpassungen müssen deshalb frühzeitig und über einen Prozess vorausschauender Strukturveränderungen gestaltet werden.
Die deutsche Braunkohlenwirtschaft
Historische Entwicklungen, Ressourcen, Technik, wirtschaftliche Strukturen und Umweltauswirkungen

Einleitung
In der 19. Legislaturperiode stehen die Verhandlungen zu einem deutschen Kohlekonsens an, die Bundesregierung hat hierzu die Gründung einer entsprechenden Kommission angekündigt. Der Umgang mit der Braunkohle wird dabei eine besondere Rolle spielen. Denn die Braunkohle ist kein Energieträger wie jeder andere: Braunkohle ist nicht nur der einzige nennenswert in Deutschland geförderte fossile Energieträger, sondern auch der klimaschädlichste. Zudem zeigte sich in der Diskussion um den Klimaschutzbeitrag der Stromwirtschaft im Jahr 2015, dass über die Braunkohle nur ein geringes Fachwissen außerhalb der drei Braunkohleunternehmen existiert.
Die vorliegende Studie dient dazu, die spezifischen Strukturmerkmale der deutschen Braunkohlenwirtschaft in historischer, politischer, wirtschaftlicher, ökologischer und regionalstruktureller Hinsicht umfassend und systematisch aufzuarbeiten und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn nur auf Basis solider und umfassender Fakten kann der notwendige Umbau der deutschen Braunkohlenwirtschaft erfolgreich gestaltet werden.
Kernergebnisse
Bibliographische Daten
Downloads
-
Studie
pdf 2 MB
Die deutsche Braunkohlenwirtschaft
Historische Entwicklungen, Ressourcen, Technik, wirtschaftliche Strukturen und Umweltauswirkungen
-
Datenanhang
xlsx 1,010 KB
Die deutsche Braunkohlenwirtschaft
Hier finden Sie die zugehörigen Daten zur Publikation "Die deutsche Braunkohlenwirtschaft".