- Autor:innen
- Christian von Hammerstein, Dr. Stefanie von Hoff (Raue LLP GmbH)
- Publikationsnummer
- 022/09-S-2013/DE
- Versionsnummer
- 1
- Veröffentlichungsdatum
-
1. September 2013
- Seitenzahl
- 36
- Projekt
- Diese Publikation wurde erstellt im Rahmen des Projektes Konzessionsabgabe und Energiewende.
Reform des Konzessionsabgabenrechts
Gutachten vorgelegt von Raue LLP
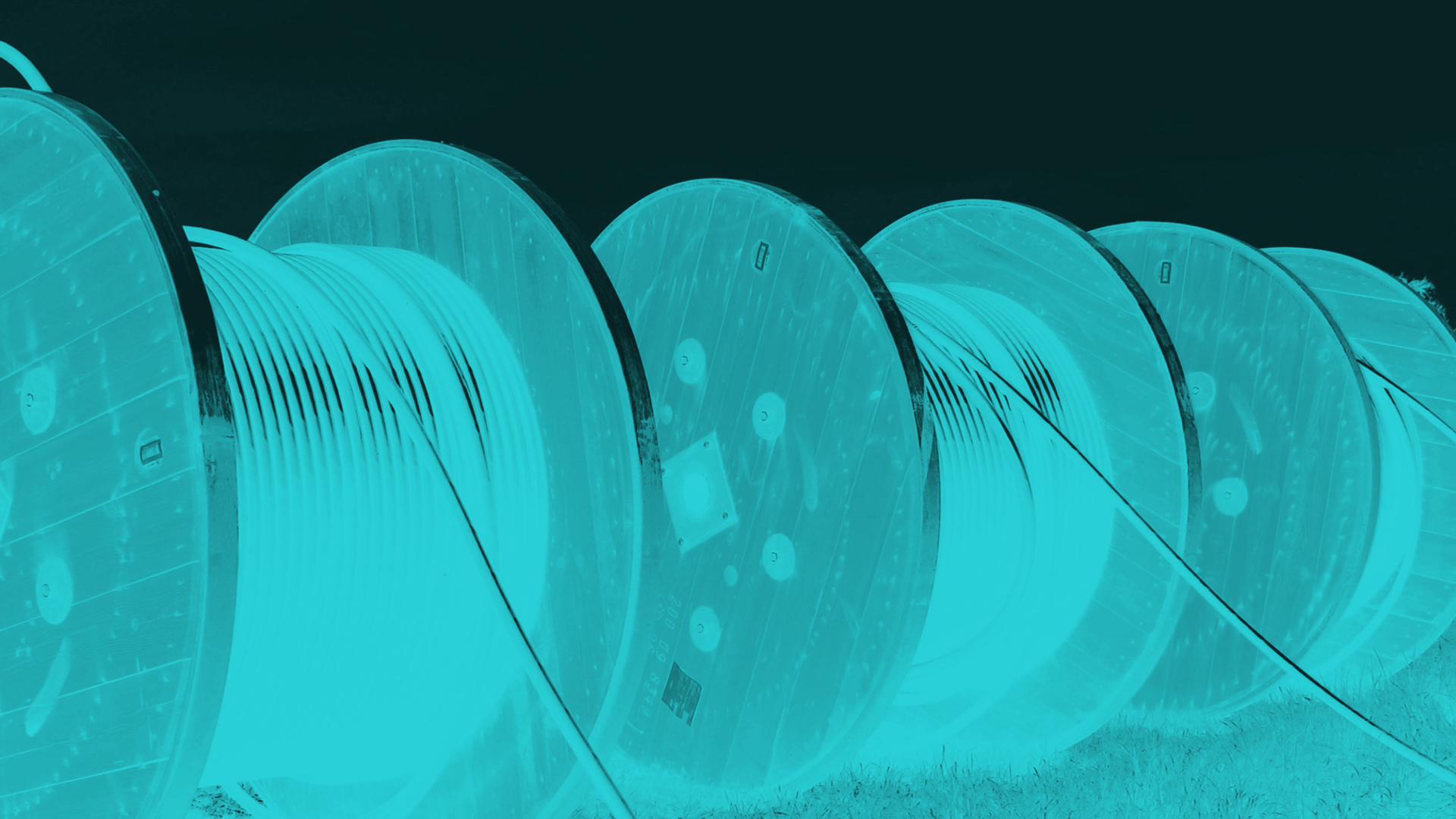
Einleitung
Nach dem jetzigen Konzept der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) gilt die Regel, dass das Kon-zessionsabgabenaufkommen einer Gemeinde steigt, je höher der Energieverbrauch ihrer Einwohner ist. Der derzeitige Mechanismus für die Kalkulation der Konzessionsabgabe entspricht daher nicht den mit der Energiewende verfolgten Zielen. Die an den Verbrauch gekoppelte Kalkulationsmethode hat nämlich folgenden paradoxen Effekt: Je mehr Strom in einer Gemeinde über Effizienzmaßnahmen eingespart und je mehr Strom von den Unternehmen und Bürgern vor Ort selbst erzeugt und ohne die Inanspruchnahme des öffentlichen Leitungsnetzes verbraucht wird (zum Beispiel durch Kraft-Wärme-Kopplungs- oder Erneuerbare-Energien-Anlagen), desto geringer sind die kommunalen Einnahmen aus der Konzessionsabgabe. Da zudem die Konzessionsabgabe für Schwachlasttarife niedriger ist, führt auch die Verbreitung von Smart Metern und – mit ihnen – von lastvariablen Tarifen zu Minderreinnahmen bei der Konzessionsabgabe.
Ziel des Projektes war es, hierfür einen Lösungsansatz zu entwickeln und einen Reformvorschlag für das Konzessionsabgabenrecht juristisch ausarbeiten lassen, um die Energiewende vor Ort zu unterstützen, gleichzeitig Einnahmen in bisheriger Höhe zu erhalten. Insbesondere sollten künftige Effizienz- und Energieeinsparmaßnahmen einer Kommune nicht durch ein gemindertes Konzessionsabgabenaufkommen bestraft werden.
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Neuigkeiten auf der Website? Erhalten Sie regelmäßige Informationen über unseren Newsletter.
Bibliographische Daten
Downloads
-
Hauptreport
pdf 1 MB
Reform des Konzessionsabgabenrechts
Gutachten vorgelegt von Raue LLP
-
Foliensatz
pdf 368 KB
Kann die Konzessionsabgabe mit der Energiewende in Einklang gebracht werden?
Vorschlag für eine neue Konzessionsabgabe

