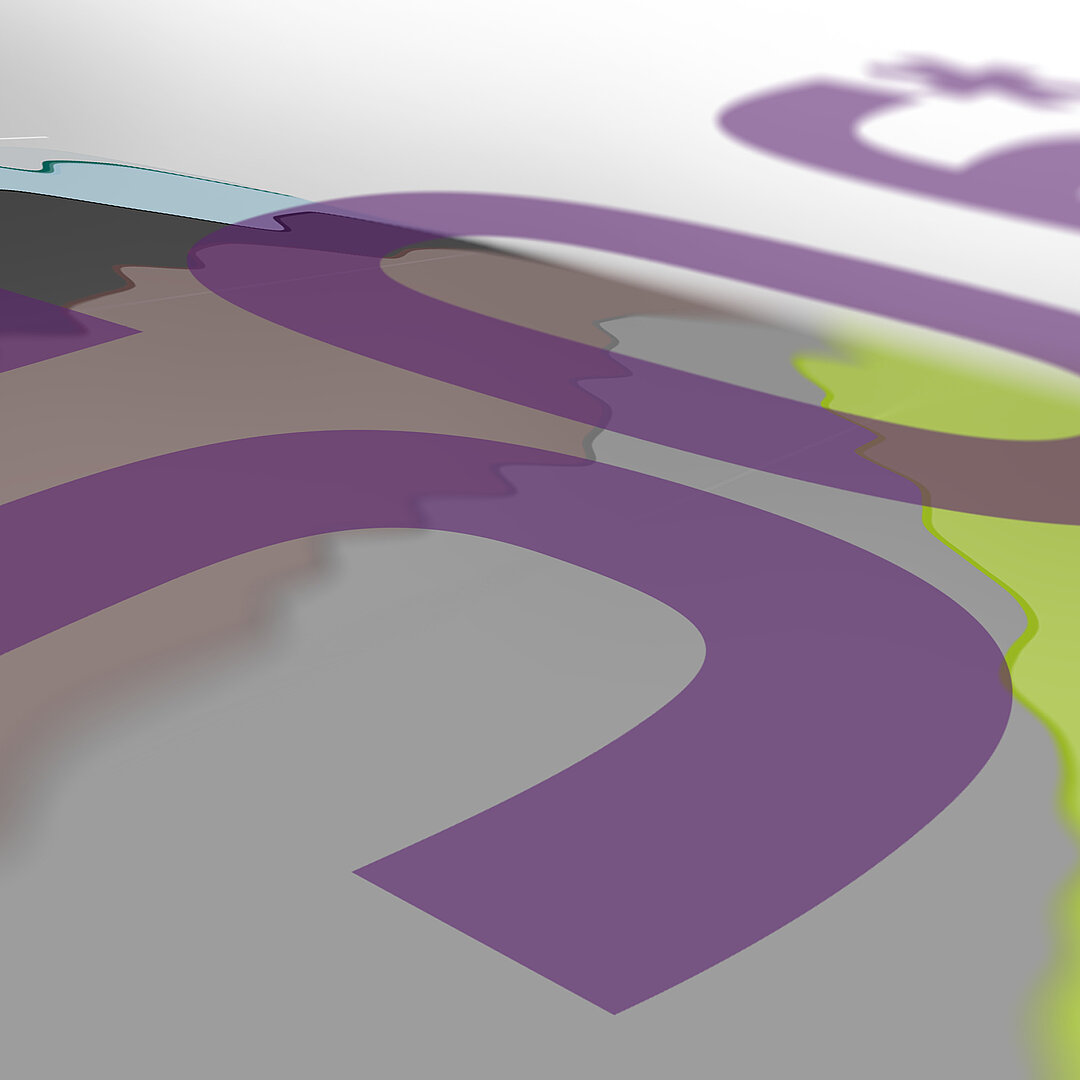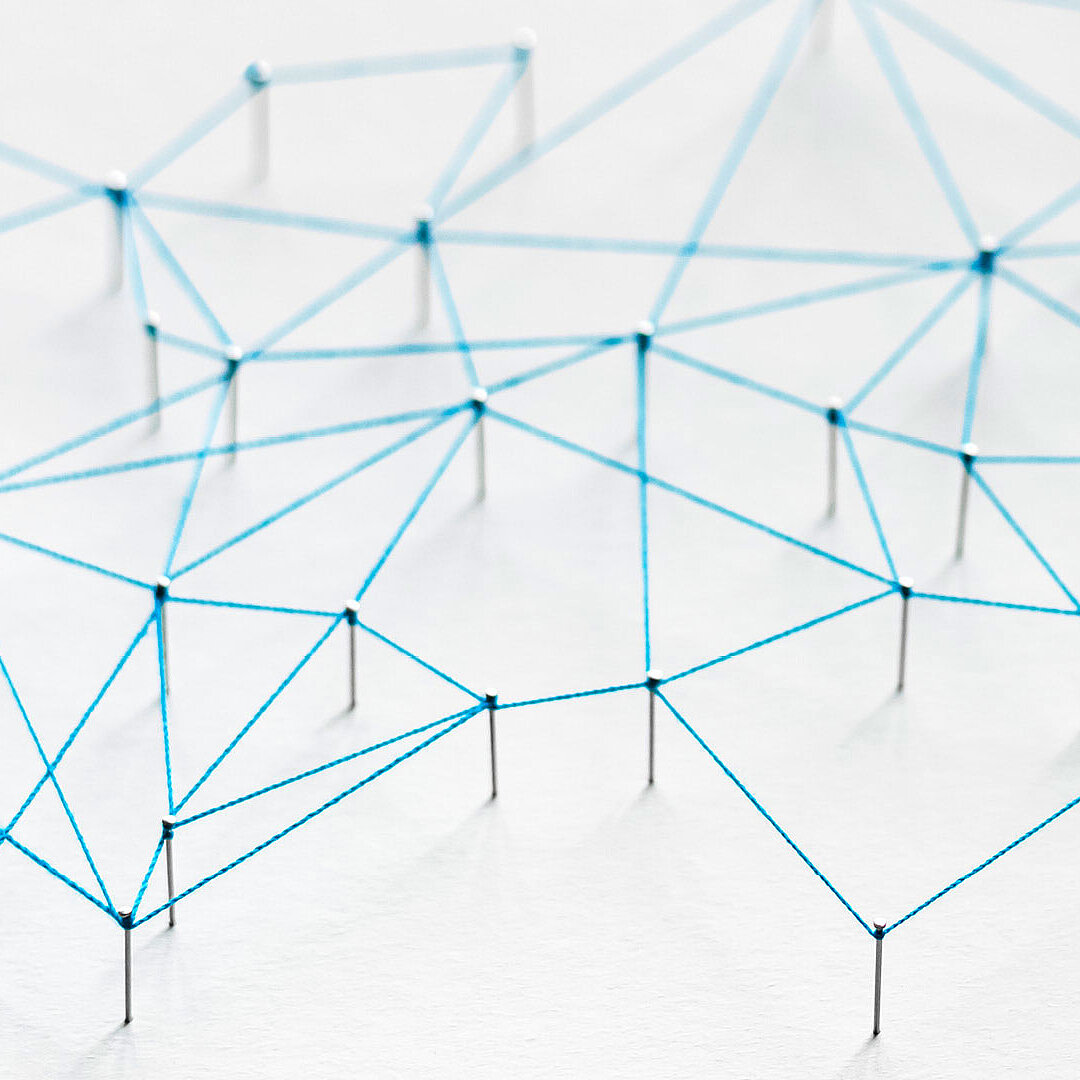Dieser Inhalt ist auch verfügbar auf: Englisch
Publikationen
Wie kann der Weg zur Klimaneutralität gelingen? In unseren wissenschaftlichen Analysen und politischen Empfehlungen stellen wir Lösungswege vor.
Publikationen von Agora Industrie finden sich unter agora-industrie.de.