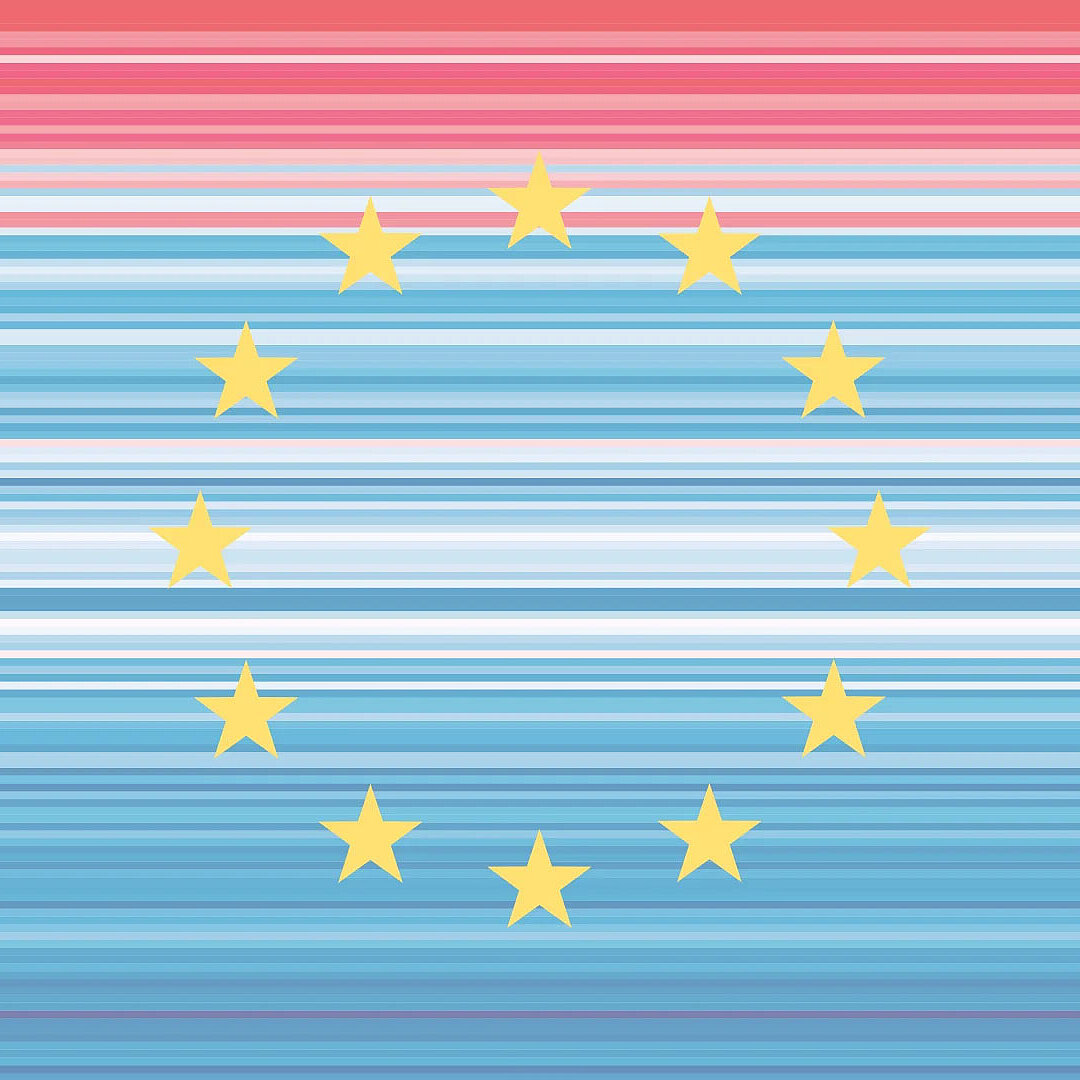Dieser Inhalt ist auch verfügbar auf: Englisch
Das große Bild einer Europäischen Energiewende 2030
Agora Energiewende legt ein Big Picture vor, wie die EU-Klima- und Energieziele erreicht werden können / Vorschlag für zehn wirksame Maßnahmen an künftige EU-Kommission und Europaparlament
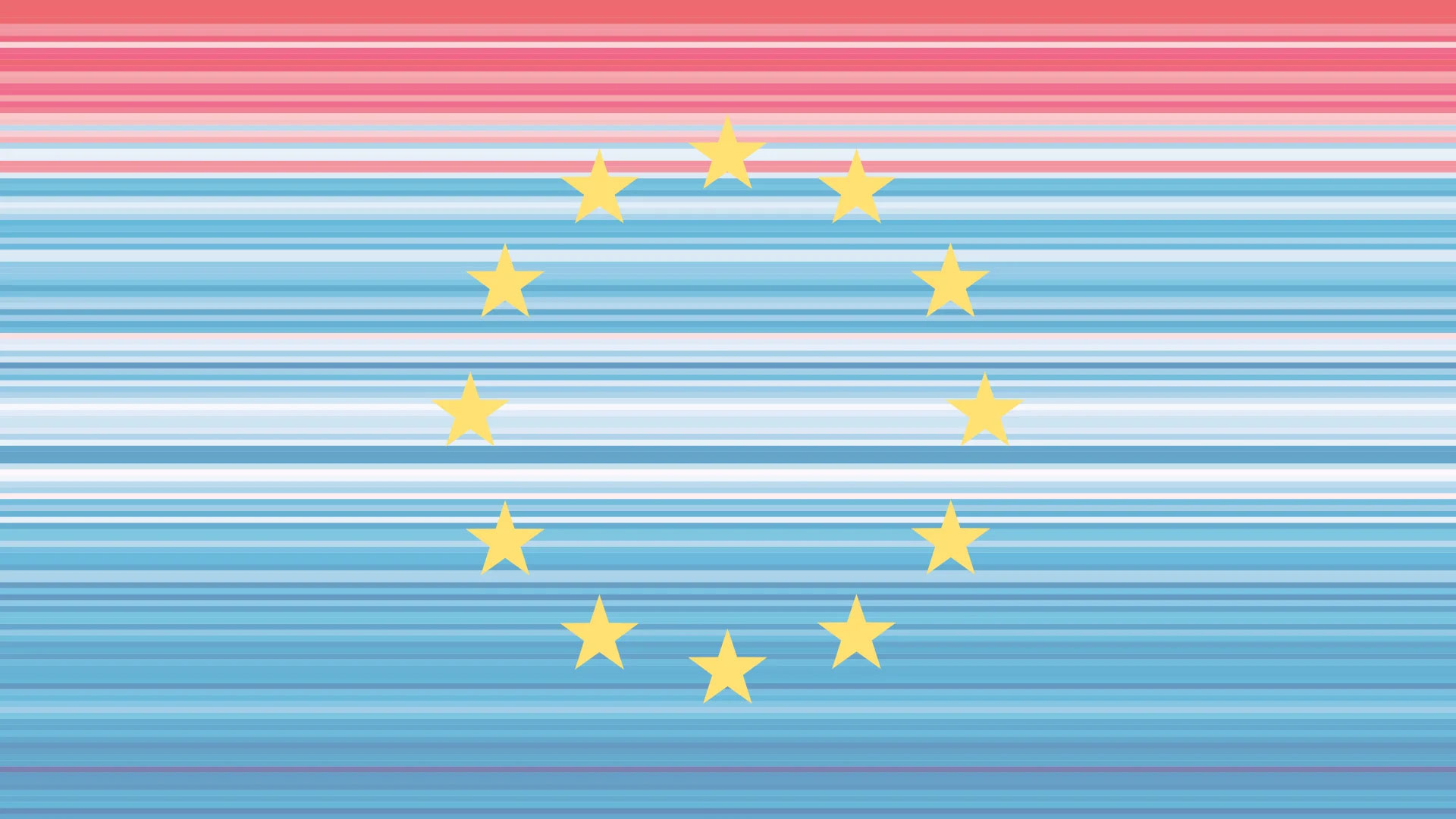
Brüssel, 6. März 2019. Bis 2030 werden die Länder der Europäischen Union deutliche Umstellungen im Energiebereich vornehmen müssen, um die EU-Klima- und Energieziele zu erreichen. Diese sehen EU-weit vor, die Treibhausgasemissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, den Primärenergieverbrauch um mehr als ein Viertel gegenüber 2005 zu verringern, und den Anteil Erneuerbarer Energien am gesamten Endenergieverbrauch auf fast ein Drittel zu steigern.
Gleichzeitig sollen die Wirtschaft innovativ, die Industrie wettbewerbsfähig und die Energieversorgung sicher sein sowie die Umstellung sozial gerecht verlaufen. So haben es die EU-Staaten und das Europäische Parlament kürzlich vereinbart.
Was diese Ziele konkret bedeuten und wie sie sich sozial ausgewogen und kosteneffizient erreichen lassen, legt Agora Energiewende in der Studie „European Energy Transition 2030: The Big Picture“ dar. Demnach verlangt die Umstellung, die Verbrennung von Kohle in der EU bis 2030 zu halbieren und den Verbrauch von Kraftstoffen, Erdgas und Heizöl um ein Viertel zu vermindern. An die Stelle der fossilen Brennstoffe treten Erneuerbare Energien, deren Anteil am EU-Energiemix sich bis 2030 verdoppeln muss. Das betrifft insbesondere die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Sie haben derzeit einen Anteil von 32,3 Prozent am EU-Strommix, dieser wird in den nächsten elf Jahren bei steigendem Stromverbrauch auf 57 Prozent wachsen. Außerdem stehen Investitionen in Energieeffizienz an, um den Energieverbrauch bis 2030 um 17 Prozent gegenüber heute zu verringern.
Optimales Spielfeld für die EU-Mitglieder
„Die EU-Ziele für Klimaschutz und Energie im Jahr 2030 bedeuten, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Energiewende einleiten, die auf einem sparsameren Umgang mit Energie, dem raschen Ausbau der Erneuerbaren Energien und dem schrittweisen Abschied von der Nutzung fossiler Energieträger basiert“, sagt Matthias Buck, Leiter Europäische Energiepolitik bei Agora Energiewende. „In dem Big Picture entwickeln wir Vorschläge für Maßnahmen auf EU-Ebene, um die Mitgliedsstaaten bei ihren nationalen Energiewenden zu unterstützen und diese wo möglich zu beschleunigen. Unsere Vorschläge zielen darauf ab, dass die nationalen Energiewenden sozial ausgewogen und wirtschaftlich günstig erfolgen. Dazu gehört auch, dass die Europäische Union bereits heute Märkte für saubere Technologien schaffen sollte, die in den Jahren nach 2030 benötigt werden: beispielsweise die Nutzung von synthetischen Brennstoffen in der Industrie und im Schiffs- und Flugverkehr“, sagt Buck.
Ein Vorschlag zur Erhöhung der Klimaziele der EU im Rahmen des Pariser Abkommens
Eine solide Umsetzung der vereinbarten EU-Klima- und Energieziele wird in der Europäischen Union den politischen Raum für die EU schaffen, um ihre Klimaziele im Jahr 2020 zu erhöhen. Dann steht der erste Überprüfungs- und Anpassungsprozess im Rahmen des Pariser Abkommens an. „Dies ist ein entscheidender Moment für die globale Klimadiplomatie. Und die Frage ist nicht, ob die EU ihre Klimaziele für 2030 erhöhen sollte, sondern um wieviel“, sagt Buck. „Wir schlagen vor, dass sich die EU zu einer 50-prozentigen Verringerung der Treibhausgase gegenüber 1990 verpflichten sollte. Davon könnten bis zu vier Prozentpunkte durch internationale Kooperationsmechanismen im Rahmen des Pariser Abkommens erreicht werden. Dieses um zehn Prozentpunkte ambitioniertere Ziel würde es der EU ermöglichen, den Weg zur Emissionsfreiheit bis 2050 einzuschlagen.“
Zehn Prioritäten für die EU nach der Europawahl im Mai
Aufbauend auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Gesprächen mit Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie Expertinnen und Experten in ganz Europa, schlägt Agora Energiewende der künftigen EU-Kommission sowie dem Europaparlament eine Liste von zehn vorrangigen Maßnahmenpaketen vor:
- Die Einrichtung eines ständigen Ausschusses für die Europäische Energiewende im Europäischen Parlament sowie die Schaffung eines neuen Dienstes bei der Europäischen Kommission, der auf Anfrage die Mitgliedstaaten dabei unterstützt, konkrete Energiewende-Herausforderungen zu bewältigen; sei es im Bereich der Gebäudesanierung oder beim kostengünstigen Zubau Erneuerbarer Energien.
- Eine Überarbeitung des europäischen Beihilferahmens, so dass dieser nationale Energiewendemaßnahmen stärker unterstützt als bisher.
- Die Festsetzung eines verbindlichen „Schattenpreises“ für CO2-Emissionen, der in allen europäischen und nationalen Infrastruktur- und Investitionsentscheidungen einbezogen wird.
- Eine frühzeitige Überprüfung und Verschärfung der CO2-Pkw-Verordnung, um das technisch machbare Potenzial für Emissionsminderungen im Individualverkehr auszureizen und die Einführung der Elektromobilität zu beschleunigen.
- Im Güterverkehr sollten die neuen CO2-Emissionsstandards für Lkw bereits im Jahr 2022 verschärft und um eine Quote für emissionsfreie Lastwagen ergänzt werden. Zudem benötigen die Mitgliedsstaaten mehr Spielraum, um Straßenbenutzungsgebühren an den Kosten von CO2-Emissionen ausrichten zu können.
- Die nächste EU-Kommission sollte ein Gesetzespaket zur schrittweisen Dekarbonisierung von Treibstoffen in der Schifffahrt und im Flugverkehr vorlegen.
- Die Schaffung einer wettbewerbsfähigen und umweltverträglichen europäischen Batterie-Industrie sollte insbesondere durch verbindliche Mindestanforderungen an die CO2-Bilanz von in Europa verkauften Batterien unterstützt werden.
- Eine EU-weite verbindliche Quote für die Beimischung von Gas aus erneuerbaren Quellen soll die Dekarbonisierung des Industriesektors unterstützen und Investitionen in Elektrolysekapazitäten von mindestens 30 Gigawatt in Europa bis 2030 absichern.
- Wie in Kalifornien bereits Recht und Gesetz, sollten auch in Europa alle öffentlichen Bauträger verpflichtet werden, schrittweise bei allen öffentlichen Bauvorhaben CO2-arm hergestellten Zement und Stahl einzukaufen. Dies schafft bei sehr geringen Zusatzkosten für die öffentliche Hand Investitionssicherheit für Unternehmen, die in fortschrittliche Produktionsverfahren investieren wollen.
- Der Bericht benennt zudem konkrete, aus Sicht der europäischen Energiewende notwendige Anforderungen, an den im Gesetzgebungsverfahren befindlichen EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027.
„Die zehn Maßnahmenpakete würden dafür sorgen, dass die umfangreichen europäischen Vorgaben für nationale Energiewenden tatsächlich umgesetzt werden, dass Europa das Ambitionsniveau dort sinnvoll verschärft wo wir die Schubkraft des europäischen Binnenmarkts benötigen und dass wir über Marktanreizprogramme industrielle Innovation dort unterstützen, wo wir bereits heute wissen, dass wir neue Produkte und verbesserte industrielle Prozesse nach 2030 brauchen“, sagt Buck.
Vier europäische Flaggschiff-Projekte zum Vorantreiben der nationalen Energiewenden
Außerdem empfiehlt das Papier der EU-Kommission vier konkrete Flaggschiff-Projekte, um die Umsetzung des Saubere-Energie-für-alle-Europäer-Paketes mit Leben zu füllen:
- Bis 2025 sollen eine Million Gebäude mit industriellen Methoden energetisch saniert werden
- Bis 2025 sollen EU-weit zehn Millionen Dächer neu mit Solaranlagen ausgestattet werden
- Fernwärme und -kühlung sollen in ganz Europa gefördert werden
- In den heutige Kohleregionen sollen Programme für eine sozial gerechte Energiewende aufgelegt werden, ähnlich wie im deutschen Kohlekonsens vereinbart
„Uns geht es mit unserer Studie darum, bereits jetzt ganz konkret zu diskutieren, welche Maßnahmen das künftige Europäische Parlament und die nächste Europäische Kommission im Bereich Klimaschutz und Energiewende nach der Europawahl im Mai voranbringen sollen. Unsere Vorschläge konzentrieren sich auf Punkte, bei denen Europa einen wirklichen und unmittelbaren Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger schafft, beispielsweise bei dem sozial verträglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung oder bei den Themen saubere Luft und behaglicheres Wohnen. Außerdem waren uns europäische Maßnahmen wichtig, die den Mitgliedstaaten dabei helfen, ihre jeweiligen nationalen Energiewenden zügig voranzubringen. Das betrifft beispielsweise die Weiterentwicklung des EU Beihilferahmens oder die Marktzulassung von Stromspeichern, die ökologisch und sozial nachhaltig sind“, fasst Buck zusammen.
Die Studie „European Energy Transition 2030: The Big Picture“ wurde am 7. März in Brüssel öffentlich vorgestellt und von einem hochkarätigen Podium diskutiert. Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung und auch die Publikation steht unten zum kostenfreien Download zur Verfügung. Sämtliche Grafiken der Studie stehen zur Weiterverwendung unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung.
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Neuigkeiten auf der Website? Erhalten Sie regelmäßige Informationen über unseren Newsletter.
Weiterlesen
Downloads
-
pdf 96 KB
Das große Bild einer Europäischen Energiewende 2030
Pressemitteilung